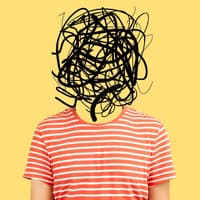Früher kannten wir sie alle: Das Mädchen, das im Schulunterricht träumerisch aus dem Fenster schaute. Die, die ständig kleckerte, etwas fallen ließ oder gegen Türrahmen stieß. Die, die manchmal so in ihrer eigenen Welt versunken war, dass sie sogar das Essen vergaß. Die Träumerliese. Es war frustrierend, denn so sehr sie sich auch anstrengte, es wollte einfach nichts klappen. Das ließ Kind und Eltern verzweifeln, denn es schien für alle Welt klar zu sein: Wenn sie sich nur gut genug anstrengte, wenn sie all ihre Sinne zusammennehmen würde, dann würde ihr das alles auch nicht mehr passieren.
Trotz aller Bemühungen keine Anerkennung
So erging es der Bloggerin Liza von Flodder, die ihre ADHS-Diagnose erst im Erwachsenenalter bekam. Wenn sie auf ihre Kindheit zurückblickt, schwingt Frustration mit. "Ich war die typische Träumerliese", sagt die 31-Jährige, die heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Hamburg lebt. "Ich habe mich enorm angestrengt und trotzdem kam ich nicht zum selben Ergebnis wie meine Mitschüler. Entweder weil ich die Aufgaben anders verstand oder meine Konzentration schnell nachließ. Es ist extrem frustrierend, wenn du alles gibst, viel lernst, dir sicher bist, dass du alle Fragen richtig beantwortet hast – und eine Woche später die rote Vier minus zurückbekommst. Und das war in den allermeisten Fällen so. Das führt dazu, dass andere den Glauben an dich verlieren. Sie denken du seist dumm oder faul, und irgendwann denkst du das von dir selbst."
Hätte Liza schon damals gewusst, dass sie ADHS hat, dann hätte sie sich den Kampf gegen Windmühlen sparen können. Hätten ihre Erzieher, ihre Lehrkräfte es nur erkannt. Dann hätte sie gewusst, dass ihr Tun kein Scheitern ist, sondern schlichtweg ihr bestmöglicher Versuch.
Auch außerhalb des Unterrichts hat das Mädchen Schwierigkeiten. Ihre Gedanken sind irgendwie anders als die der anderen Kinder. "Ich habe oft nach der Schule bei meiner Mutter geweint, weil ich die anderen Kinder einfach nicht verstanden habe." Sie eckt bei ihren Altersgenossen immer wieder an, wird zur Außenseiterin und macht Mobbingerfahrungen.
Innere Unruhe ist nicht sichtbar
Es ist bezeichnend, dass man ADHS noch bis vor wenigen Jahren das "Zappelphilipp-Syndrom“ nannte. Hyperaktivität und Raubboldentum schienen untrennbar zu den Symptomen zu gehören. Lebhaft, unruhig und hibbelig müsse ein Kind mit ADHS sein. Doch die ADHS-Symptomatik bei Mädchen sieht oft völlig anders aus. Die Idee, dass innere Unruhe immer von außen als solche erkennbar sein muss, ist überholt. Eine "Zappelphilippine" gibt es selten. Dafür gibt es umso mehr Bummellieschen, Quasselstrippen und eben Träumerliesen. So wurde – und wird – ADHS viel häufiger bei Jungs diagnostiziert. Dies ist ein immer wiederkehrendes und mittlerweile bekanntes Phänomen in der Medizin: die "Gender Data Gap". Das bedeutet, Datenerhebungen (in diesem Fall Verhaltensbeobachtungen) werden zu Ungunsten eines Geschlechts gemacht. Dies geschieht, indem beispielsweise nur an männlichen Probanden geforscht wird oder aber – wie bei ADHS – der gesellschaftliche Kontext ausgeklammert wird. Dadurch werden die medizinischen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen unsichtbar gemacht. Und dadurch auch ihr Leidensdruck.
Soziale Situationen überfordern
Dieses Phänomen kennt auch die Psychologin Theda Pollmann: "ADHS ist eine der psychischen Erkrankungen, die sich in den unterschiedlichsten Formen zeigt. Das allgemeine Klischee ist die Hyperaktivität", erklärt sie. "Ist ein Kind öfter psychomotorisch unruhig und kann sich zum Beispiel im Schulunterricht nicht regulieren, wird schnell die ADHS-Karte gezückt, gerade bei Jungen im Grundschulalter. Schnell wird die nötige umfangreiche Diagnostik vergessen, das 'Offensichtliche' interpretiert." Anders als bei der typischen Hyperaktivität bei Jungen würden oft Symptome wie die von Liza nicht erkannt.
Die Psychologin wundert es außerdem nicht, dass das Verhalten ihrer Umwelt Liza zur Verzweiflung brachte. Dies würde an der Entwicklung des präfrontalen Kortex liegen. Dieser Teil der Großhirnrinde sei unter anderem für die Emotionsregulierung, Steuerungsfähigkeit und Impulskontrolle zuständig. "Hier kann man selbst bei einer geringeren Ausprägung des Störungsbildes eine Unteraktivität feststellen, die dazu führt, dass soziale Situationen als Überforderung und Reizüberflutung wahrgenommen werden", erklärt Pollmann.
Ein echter Aha-Moment
Als Liza nach der ADHS-Diagnose zum ersten Mal Medikamente nimmt, wird ihr schmerzhaft bewusst, was sie bisher durchgemacht hat: "Ich begriff, dass das Leben gar nicht so anstrengend sein muss. Wenn man 30 Jahre lang mit seinen Symptomen lebt, ohne zu wissen, dass man eine Störung hat und dann plötzlich ein Medikament bekommt, kann man sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man sehr lange in einem Raum mit vielen Nebengeräuschen sitzt, aber wegen der Aufenthaltsdauer realisiert man diesen Lärm gar nicht mehr. Jedenfalls nicht bewusst. Bis plötzlich jemand alles leise macht, man seinen eigenen Atem hört und endlich zur Ruhe kommt."
Noch mehr Aufklärung ist nötig
Der undifferenzierte Blick unserer Gesellschaft auf ADHS geht auf Kosten der Mädchen. Es ist ihr Leidensdruck, der unsichtbar bleibt, solange Eltern, Kitas und Schulen die Anzeichen nicht erkennen. Biografien, die umgeschrieben hätten werden können, hätte Aufklärung stattgefunden. Theda Pollmann fasst die Thematik folgendermaßen zusammen: "ADHS bleibt eine komplexe Erkrankung, die die Forschung weiter beschäftigen wird. Die Häufigkeit ist in den letzten Jahren stark angestiegen, und es benötigt zukünftig eine genauere differenzialdiagnostische Betrachtung und mehr zugeschnittene Therapieplanung, um Leidenswege wie den von Liza schneller verhindern zu können."
Auch Liza findet, dass es mehr Aufklärung braucht. "Noch immer wissen zu wenig Menschen, dass es ADHS auch bei Mädchen gibt. Noch immer denken so viele, dass es ADHS gar nicht gibt. Dass es eine ausgedachte Krankheit ist. Diesen Menschen würde ich gerne für einen Tag meinen Kopf leihen. Aber da das nicht möglich ist, werde ich einfach weiter darüber reden", sagt die Bloggerin. Heute hat sie ihre Störung angenommen: "ADHS gehört zu meiner Identität. Ich kenne die Vor- und Nachteile und würde es nicht mehr hergeben wollen, wenn ich die Wahl hätte."
Autorin: Hannah Struck