Dieser Artikel enthält unter anderem Produkt-Empfehlungen. Bei der Auswahl der Produkte sind wir frei von der Einflussnahme Dritter. Für eine Vermittlung über unsere Affiliate-Links erhalten wir bei getätigtem Kauf oder Vermittlung eine Provision vom betreffenden Dienstleister/Online-Shop, mit deren Hilfe wir weiterhin unabhängigen Journalismus anbieten können.
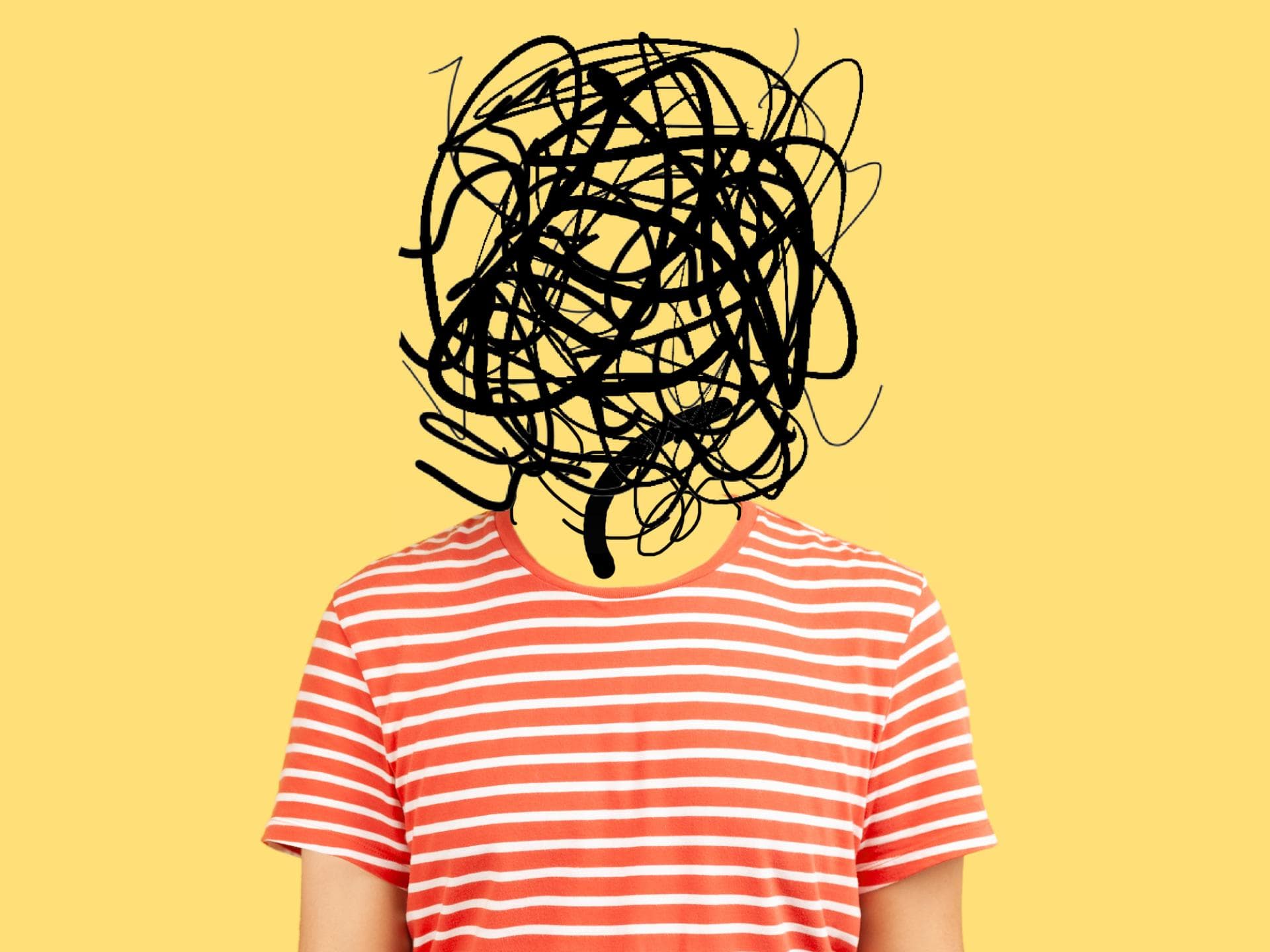
"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht." Dieser Spruch hängt in der Ergotherapiepraxis, in der Ursula Frühe über viele Jahre ein und aus ging." Das hat mich immer getröstet", erzählt die dreifache Mutter. Denn: Mit der Diagnose ADHS begann für ihre Familie ein neues Lebenskapitel, das von Höhen und Tiefen, Erfolgen und Rückschlägen geprägt war.
Zwei ihrer drei Söhne haben ADHS. In den vergangenen gut 15 Jahren brauchte die Pädagogin und Autorin ("Neuronengewitter: Mein Kind, seine ADHS, und was uns gerettet hat") vor allem zweierlei: Geduld und ganz viel Durchhaltevermögen.
Laut, zappelig, impulsiv, einfach zu viel – diesen Vorurteilen begegnen Kinder mit ADHS immer wieder. Ursula Frühe jedoch weiß: "Oft haben gerade ADHS-Kinder ein außergewöhnlich künstlerisches, schöpferisches oder innovatives Potenzial durch ihre assoziative Art des Denkens, also der Eigenart, ungewöhnliche Themenfelder miteinander zu verknüpfen."
ADHS ist keine Krankheit
Dass Menschen mit ADHS nicht krank sind, bestätigt auch Kinderarzt Vitor Gatinho in seinem Buch "Wenn die Laus zuckt und der Zahn wackelt": "Würden sie jeweils in einer Welt mit ihresgleichen leben, hätten sie wenig Probleme, weil alles an ihre besonderen Bedürfnisse angepasst wäre. Sie haben nun mal ein Gehirn, das einfach anders wahrnimmt."
Doch auch wenn ADHS viele Gesichter haben kann, so haben beinahe alle Betroffenen dennoch eine Gemeinsamkeit: Bis zur Diagnose ist es meist ein langer und steiniger Weg. Bei Ursula Frühes ältestem Sohn begann mit Eintritt in die erste Klasse der Leidensdruck, der sie zwang, aktiv zu werden. "Im Jahr 2008 war der Weg zur Diagnose noch abenteuerlich", erinnert sie sich. "Weder im Kindergarten, in der Schule noch beim Kinderarzt fielen jemals diese vier Buchstaben als Verdacht – vielleicht auch, weil unser Sohn nicht die damals stereotypen Symptome von Hyperaktivität hatte. Er war kein Zappelphilipp, sondern der geistig abwesende Träumer." Erst der zufällige Hinweis einer Bekannten brachte sie auf die richtige Spur. Gewissheit erhielt sie schließlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik.
ADHS-Medikamente – zu Unrecht umstritten?
Auch wenn die Diagnose zunächst die langersehnte Klarheit brachte, folgte schnell die nächste Frage: "Und was nun?" Die Therapie bei ADHS muss individuell abgestimmt sein, es gibt kein festgelegtes Schema. Umso wichtiger ist Aufklärung: "Eltern müssen Bescheid wissen, auch über die Risiken von Nicht-Behandlung. Für uns war die Medikation ein unverzichtbarer Teil der Therapie", erklärt sie. Dass ADHS-Medikamente bis heute umstritten sind, ist Ursula Frühe nicht nachvollziehbar. "Noch immer kursiert die medizinisch unhaltbare These, wir würden unsere Kinder damit ruhigstellen und ihre Persönlichkeiten verändern."
Es sei ein Mythos, dass Kinder mit ADHS durch Medikamente betäubt werden, bestätigt auch Vitor Gatinho. Wer das behauptet, habe "etwas Grundlegendes nicht verstanden. Die Medikamente bei ADHS sind Stimulanzien." Ob Medikamente nötig sind, hängt laut dem Mediziner vom Einzelfall ab. "Sie können dem Kind helfen, einen Zugang zu sich selbst und seinem Wissen zu finden, sind aber kein alleiniges Allheilmittel", erklärt der Kinderarzt. Laut Leitlinie der Behandlung von ADHS zählen Verhaltenstherapie, Elterntraining, Ergotherapie und Neurofeedback neben Medikamenten zu den Hauptsäulen der Therapie.
Die ersten ADHS-Anzeichen zeigen sich früh
ADHS kann sich bereits im Vorschulalter zeigen, intensiviert sich jedoch zum Schuleintritt. So war es auch bei Ursula Frühes Söhnen. "Unser erstes Kind hatte von Geburt an eine signifikante motorische Entwicklungsverzögerung. So lernte es erst mit 22 Monaten das Laufen, auch die Sprache kam stark zeitverzögert. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass es alle Umweltreize mit unglaublich wachen Augen und hoher Sensibilität aufnimmt, aber noch nicht entsprechend verarbeiten kann. Es hatte im ersten Lebensjahr große Hautirritationen, erste Allergien, Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme und war sehr schreckhaft", erinnert sie sich. Erst rückblickend bringt sie diese Anzeichen mit ADHS in Zusammenhang.
War ihr ältester Sohn der unaufmerksame und leicht ablenkbare Typ, hatte es der Jünste vor allem schwer durch seine ungebremsten Impulse und Emotionen.
Schon früh zeigte sich bei beiden eine hohe Empfindsamkeit für alle Arten von Sinnesreizen wie Geräusche, Berührungen oder Gerüche. "Alles wird intensiver wahrgenommen und empfunden, die auslösende Schwelle für Nervenreize scheint insgesamt herabgesetzt und sehr sensitiv." Das Wort Aufmerksamkeitsdefizit ist deshalb aus ihrer Sicht unpassend.
Ihnen fehlt 'nur' der Filter. Sie sind mit einer anderen, weniger selektiven, Art von Aufmerksamkeit ausgestattet, die heutzutage weniger gefragt ist und deshalb defizitär zu sein scheint.
ADHS: zwischen hyperaktiv und verträumt
"Menschen mit ADHS können sich durchaus konzentrieren. Nur muss das, auf das sie sich konzentrieren sollen, spannend und aufregend sein", erklärt Vitor Gatinho. "Alles, was neu und interessant ist, führt im Gehirn zur Dopaminausschüttung. Und genau das ist das, was diesen Kindern fehlt."
Bei ihren Lieblingsbeschäftigungen geraten Kinder mit ADHS in einen Hyperfokus, können sich stundenlang konzentrieren. Langweilige Routinen oder stilles Sitzen hingegen führt nicht zu Dopaminausschüttungen und fällt ihnen damit schwer.
ADHS gliedert sich in drei Unterformen:
- ADHS mit eher unaufmerksamer Ausprägung: Die Kinder kämpfen mit Aufmerksamkeitsproblemen, sind meist jedoch nicht hyperaktiv, sondern wirken eher verträumt.
- ADHS mit hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild: Dieser Typ zeichnet sich durch Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und erhöhte Impulsivität aus.
- der kombinierte Typ, der am häufigsten vorkommt.
"Neurodivergente haben manchmal das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu leben, sie müssen das 'normale' Verhalten oft erst lernen, um ihr eigenes ursprüngliches Verhalten zu maskieren, verstehen es oft nicht und brauchen gerade am Anfang ihre Eltern als eine Art Dolmetscher", erklärt Dr. Vitor Gatinho.
Fehlende Unterstützung kann also fatale Auswirkungen haben. Ursula Frühe ist wütend über die Ungerechtigkeiten, die Kinder mit ADHS auch heute noch oft in der Schule erleben. Etwa fünf Prozent aller Kind sind von ADHS betroffen. "Das ist kein Randphänomen, es sind richtig viele, deren Startchancen für eine erfolgreiche Bildungsbiografie schon vor ihrer Einschulung herabgesetzt ist", sagt sie. "Kinder mit ADHS müssen sich viel mehr anstrengen, um dasselbe Resultat zu erzielen. Dafür brauchen sie unsere Unterstützung. Wer sie vom Elternhaus, von dem zu viel abhängt, nicht bekommt, wird abgehängt."
Entsprechend wichtig ist es, dass sich Eltern für ihre Kinder einsetzen. Damit den Kinder adäquat geholfen werden kann, müssen Eltern offen über ihre Probleme sprechen. "Falsche Scham hilft uns nicht weiter", so Ursula Frühe.
ADHS im Erwachsenenalter
Lange ging man davon aus, dass ADHS mit dem Ende der Pubertät vorbei sei. Heute weiß man: Das stimmt nicht. Es wurde bei vielen Erwachsenen schlechtweg nie erkannt oder diagnostiziert. Mindestens zwei Drittel nehmen ihre Symptome mit ins Erwachsenenalter, oftmals kommen dann zusätzlich Erkrankungen wie Depression und/oder Suchterkrankungen hinzu.
Beginnt die ADHS-Therapie bereits im Kindesalter, haben Kinder die besten Chancen, sich selbst akzeptieren zu lernen und gleichzeitig Coping-Strategien zu entwickeln, um beispielsweise mit ihren Konzentrationsproblemenen, ihrer Vergesslichkeit oder ihrer scheinbaren Unzuverlässigkeit umzugehen.



