Dieser Artikel enthält unter anderem Produkt-Empfehlungen. Bei der Auswahl der Produkte sind wir frei von der Einflussnahme Dritter. Für eine Vermittlung über unsere Affiliate-Links erhalten wir bei getätigtem Kauf oder Vermittlung eine Provision vom betreffenden Dienstleister/Online-Shop, mit deren Hilfe wir weiterhin unabhängigen Journalismus anbieten können.

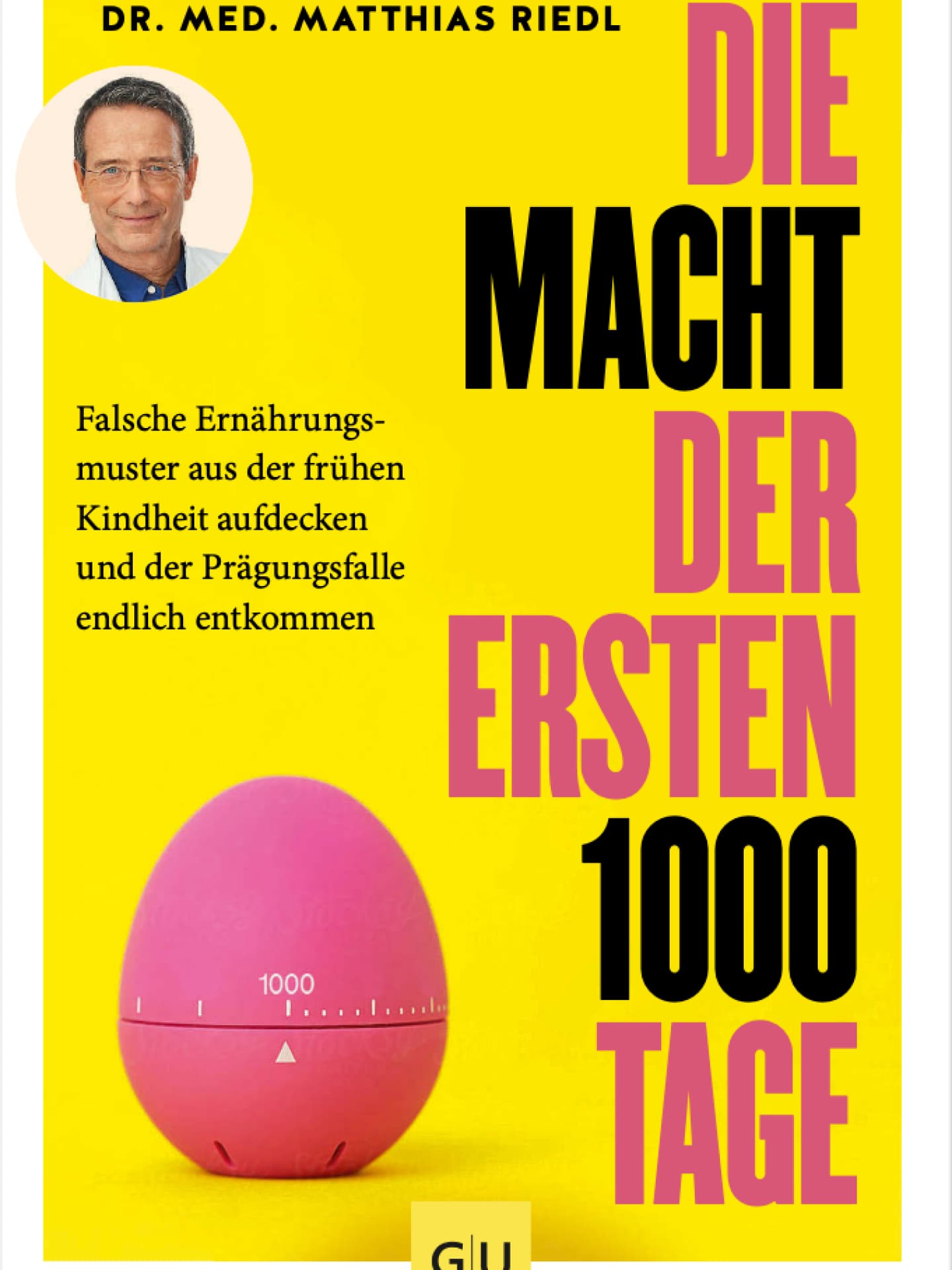
Dr. Matthias Riedl ist Diabetologe, Ernährungsmediziner, Internist, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor bei Medicum Hamburg. Er hat ein Buch über Ernährungsmuster aus der frühen Kindheit geschrieben, das er allen Eltern, aber auch Großeltern, Tanten und Onkeln empfiehlt: "Die Macht der ersten 1000 Tage. Falsche Ernährungsmuster aus der frühen Kindheit aufdecken und der Prägungsfalle endlich entkommen" GU, 10 Euro. In einem Interview zum Thema, warum man Essen nicht an Gefühle koppeln sollte, beantwortet er uns einige wichtige Fragen. Weitergehende Informationen dazu findet ihr in seinem Buch.
Trösten ja, aber bitte ohne Süßigkeiten!
Natürlich ist es verständlich, dass wir unsere Kleinen trösten wollen. Und Süßigkeiten helfen nun mal – so scheint es. Doch leider kann diese Methode unerwünschte und gravierende Folgen haben. Warum wir Essen nicht aktiv an Gefühle koppeln sollten, verrät uns im folgenden Interview der Diabetologe, Ernährungsmediziner und Internist Dr. Matthias Riedl. Er weiß aus eigener Erfahrung, welch starke Einflüsse kindliche Prägung bis ins Erwachsenenalter hinein hat: Er musste als Kind immer seinen Teller leer essen und leidet noch heute darunter, wenn ihm jemand gegen Ende noch etwas auftut. Dann fühlt er sich verpflichtet aufzuessen, auch wenn er keinen Hunger mehr hat.
Herr Dr. Riedl, Stillen nach Bedarf – würden Sie sagen, das wird heute übertrieben umgesetzt?
Dr. Matthias Riedl: Heute haben sich die Ansichten des zeitlich getakteten Stillens in einem festen Rhythmus geändert. Die meisten Kinderärzt*innen und Hebammen raten mittlerweile zum Stillen nach Bedarf, da Babys in ihrem Stillverhalten viel zu verschieden sind. Dieser Ansatz orientiert sich daher unmittelbar am Kind und seinen individuellen Bedürfnissen – es entscheidet, wann und wie lange gestillt wird. Außerdem ist Stillen weit mehr als Ernährung. Es unterstützt das Beziehungsgeschehen zwischen Mutter und Kind und dient zudem der Beruhigung – daran ist somit nichts verkehrt. Dabei wird ein unverzichtbares Hormon, das auch als Kuschelhormon bekannt ist, ausgeschüttet – Oxytocin. Die Nähe zur Mutter, die Ruhe und Geborgenheit sind daher bedeutsame emotionale Aspekte, die nicht vergessen werden dürfen. Wichtig ist grundsätzlich, dass eine Mutter intuitiv auf die Bedürfnisse ihres Babys reagiert und die individuellen Signale richtig deutet. Nur sie weiß, ob das Baby mit seinen Signalen Hunger, Einsamkeit, Zuwendungsdefizit oder auch Langeweile ausdrückt und wie sie am besten darauf reagiert. Übrigens kommen Kinder mit einem hervorragenden Gefühl für Hunger und Sättigung zur Welt. Sie machen sich lautstark bemerkbar. Wenn Eltern die kindlichen Signale falsch interpretieren und den Wunsch nach Nähe mit Füttern beantworten oder – noch schlimmer – dem Kind bei jeder Lebensäußerung Nahrung anbieten, dann kann hier schon der Grundstock für späteres Übergewicht gelegt werden.
Trotzanfälle in der Öffentlichkeit mit einem Schokoriegel abmildern oder Kinder mit einem Eis trösten – wozu kann das führen?
Das Verlangen nach Aufmerksamkeit, Zuwendung, Nähe und Geborgenheit kann bei Kindern unterschiedliche Verhaltensweisen auslösen. Manche versuchen, durch Trotzanfälle die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, bei anderen Kindern kullern bei Traurigkeit Tränen die Wangen hinunter. Den Eltern ist es nicht zu verübeln, dass sie die Situation schnellstmöglich unter Kontrolle und ihre Lieblinge beruhigen möchten. Dabei arbeiten viele Eltern allerdings mit einem Ruhigstellsystem durch die Gabe von Süßigkeiten. Wird ein Kind nun vermehrt mit etwas Süßem ruhiggestellt, lernt es daraus und merkt sich diese Reaktion genau. Wird dies erst zu einem ungesunden Verhaltensmuster aus Aktion und Reaktion, wird das Kind auf lange Sicht nicht mehr ohne den Schokoriegel oder das Eis in frustrierenden Situationen auskommen können, um sich zu beruhigen. Denn so wurde es ja von Mama und Papa gezeigt, dann muss es richtig und für mich das Beste sein. Es kann auch passieren, dass Kinder diese Handlungsabfolge nutzen und öfter Trotzanfälle haben, auch wenn es gar keinen Grund dafür gibt. Daher ist es wichtig, als Elternteil andere Mittel zum Zweck zu nutzen als Süßes oder Essen allgemein. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass der Geschmack für Süßes verändert und sich abflacht. Stark gezuckerte Lebensmittel schmecken mit der Zeit weniger süß und das Verlangen nach mehr wird größer, denn Zucker ist ein Suchtmittel. Des Weiteren sorgen viele (süße) Zwischenmahlzeiten dazu, dass das Kind zu den Hauptmahlzeiten weniger Hunger mehr hat und ihm somit wichtige Vitamine und Nährstoffe fehlen, weil es die eigentlich gesunde Kost nicht ausreichend isst.
Schnell ist es passiert – wir Eltern sagen: "Wenn du nicht aufisst, gibt’s auch keinen Nachtisch." Was ist daran falsch?
Kindern ein gesundes Essverhalten beizubringen ist nicht leicht. Manchmal nutzen Eltern Phrasen, die allerdings das Gegenteil bewirken. Ob Bestechung oder Drohung – oft ist uns Eltern die Wirkung unserer Worte gar nicht bewusst. Den Teller immer aufessen zu müssen ist ein Paradebeispiel dafür und führt dazu, dass die Kinder nicht ihr eigenes Sättigungsgefühl kennenlernen können. Sie lernen allerdings nur langsam, wie viel sie von etwas brauchen, um ihren Hunger zu sättigen, und in der Regel haben sie sich nicht einmal selbst den Teller aufgefüllt. Es ist also empfehlenswert, die Kinder selbst lernen und einschätzen zu lassen, wie viel sie schaffen und wann sie satt sind. Mehr dazu in meinem Buch. Und ausschließlich das Aufessen mit einem Nachtisch zu verknüpfen ist eine Form der Erpressung, die bedeutend wenig mit der Vermittlung eines gesunden Essverhaltens einhergeht. Jeder am Tisch sollte Nachtisch bekommen, unabhängig davon, ob aufgegessen wurde oder nicht. Bei meinen Vorträgen frage ich häufig, wer aus dem Auditorium solche Regeln kennengelernt hat, meist melden sich über 50 Prozent. Bei vielen ist dieser frühkindlich erlernte Reflex, den Teller blitzblank zu hinterlassen, zu einem unbewussten Drang geworden. Fatal für diejenigen, die eine Neigung zu Übergewicht haben.
Wenn Kinder selbst anfangen zu fragen: "Wenn ich gut mitmache, bekomme ich dann was Süßes?" Wie reagiert man am besten darauf?
Bei der Assoziation von gutem Verhalten und Essen als Belohnung ist große Vorsicht geboten – denn Lebensmittel sind kein Erziehungsmittel. Essen sollte man nie als Mittel zum Zweck verwenden, so wie in diesem Fall als Belohnung für ein gutes Verhalten des Kindes. Fängt der Nachwuchs selbst mit diesem Verhaltensmuster an und fragt von sich aus, ob es durch etwas Süßes belohnt wird, gilt es, sofort einzuhaken. Am besten unmittelbar verdeutlichen, dass die Gabe von Essen kein besonderes Verhalten voraussetzt, sondern unabhängig davon stattfindet. "Egal, wie es gleich bei den Besorgungen und Einkaufen läuft und wie gut du mitmachst – wenn wir beide im Anschluss Lust auf etwas haben, können wir uns gern etwas teilen!" wäre eine Möglichkeit. Noch ein wichtiger Tipp: Der Umgang mit Süßigkeiten will gelernt sein. Süßes hat seine Tageszeit, seine Menge und seinen Anlass. All das sollten Eltern ihren Kindern rechtzeitig vermitteln.
Was ist denn schlimm daran, wenn wir uns und unsere Kinder mit etwas Leckerem belohnen?
Gerade bei jüngeren Kindern werden Signale wie Müdigkeit, Wut, Langeweile, aber auch der Wunsch nach Zuwendung und Aufmerksamkeit von den Eltern oft falsch verstanden und fehlgedeutet. Wenn ein Kind in manchen Situationen vor allem mit Essen getröstet, abgelenkt und bei Erfolg damit belohnt wird, lernt es kaum oder nur schwer, anders mit solchen Situationen umzugehen. Verbinden Kinder Schokolade und andere kalorienreiche Nahrungsmittel unbewusst mit der Zuwendung ihrer Eltern, sorgt dies auch in ihrem späteren Leben dafür, dass sie sich beim Verzehren dieser Produkte gut fühlen – was wiederum ein Anreiz ist, davon mehr zu konsumieren und sich selbst zu belohnen. Dies ähnelt einer Art Essdressur, bei der die Hunger- und Sättigungssignale der Kinder eine lediglich untergeordnete Rolle spielen. Mit der eigentlichen Funktion des Essens als Nahrung hat dies nichts mehr zu tun. Des Weiteren löst Süßes in unserem Belohnungssystem des Gehirns den Glücksbotenstoff Dopamin aus, der uns dazu verleitet, eine Handlung – in dem Fall Naschen – immer und immer wiederholen zu wollen. All dies fördert ungünstige Essgewohnheiten. Und im Erwachsenenalter fällt es uns deutlich schwerer, das angewöhnte Verhalten der Belohnung durch Süßigkeiten wieder abzulegen. Erwachsene, die unter dieser Prägung leiden, sagen dann solche Sätze wie: "Das habe ich mir jetzt verdient", wenn sie nach einem stressigen Tag zu Süssigkeiten greifen, um ihre Stimmung zu pushen.
Gilt das in gleichem Maße für etwas zu essen und für (beispielsweise süße und bei Erwachsenen alkoholhaltige) Getränke?
Das ist beides vergleichbar, ja. Auch Getränke können als Mittel zum Zweck der Beruhigung oder Belohnung dienen, um sich besser zu fühlen, Stress abzubauen oder Problemen kurzzeitig zu entgehen. Bei alkoholhaltigen Getränken schwingt allerdings noch das Zellgift Alkohol mit, das es nicht zu vergessen und unterschätzen gilt. Den Krimi immer mit einem Glas Wein verbinden oder die gezuckerte Limonade trinken. Einmal angewöhnt greift man in entsprechender Situation automatisch zu und das Belohnungssystem schließt seinen Kreis. Die Psychologen nennen das eine Verhaltenssucht. Übrigens müssen Eltern Kindern und Jugendlichen früh den kulturellen Umgang mit Süßem wie mit Alkohol vermitteln. Es sollte sich einfach falsch anfühlen, am Vormittag ein Glas Wein zu trinken oder einfach außer der Reihe on the go Schokolade zu naschen.
Was wäre eine gute Alternative?
Die häufig im Kindesalter eingeschlichene Zweckentfremdung von Essen umdenken und ein für die eigene Familie passendes Belohnungssystem entwickeln. Eine verdiente Belohnung kann auch in Form von Bewegung sein, wie beispielsweise ein Spaziergang oder ein Ausflug zum Spielplatz, aber auch das Sammeln von Stickern oder das Vorlesen eines Extrakapitels aus dem Lieblingsbuch. Eine hervorragende Gelegenheit, den Kindern Nähe, Zeit und Liebe zu schenken. Und wenn es in manchen Situationen doch zum Naschen kommt, ist es ratsam, lieber zu gesunden Alternativen wie Obst, Gemüse oder Nüssen zu greifen. Ein Tipp: Wer außer der Reihe Hunger bekommt, hat vielleicht einfach nur Durst – das hält das Gehirn nicht so gut auseinander – oder zu wenig zu den Hauptmahlzeiten gegessen. Das gilt es, herauszufinden und entsprechend den Ursachen zu handeln. Oder eben, wie schon erwähnt, es hat sich eine Verhaltenssucht eingeschlichen – nach dem Muster, wenn (z. B. ich nach Hause komme), dann ... (esse ich immer Schokolade). Das lässt sich aber "überschreiben" mit neuen Gewohnheiten: zum Beispiel ein schöner Lieblingstee, Früchte oder bei Erwachsenen ein Espresso.
Welche Rolle spielen wir Eltern dabei als Vorbilder? Müssen wir also unser eigenes Verhalten unserer Kinder zuliebe ändern?
Ich rate allen, die Eltern werden wollen, ihre eigene Ernährung auf gesund zu polen. Eltern müssen Vorbild sein und das beginnt schon, wenn das ungeborene Kind das Essen der Mutter schmeckt und erst recht nach der Geburt. Ich rate zu einem Check mit der "MyFoodDoctor App". Sie analysiert die Ernährung, gibt Tipps zur Verbesserung und coacht das Verhalten. Wenn Eltern wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert, sind sie ein gutes Vorbild für den Nachwuchs.
Die wirksamsten Formen des Lernens sind beobachten und imitieren. Es ist es daher wenig verwunderlich, dass Kinder ihre Eltern als ihre größten Vorbilder ganz genau beobachten. Unser Nachwuchs möchte genauso groß sein, um genau das zu können, was wir Erwachsene ihnen vorleben. Ohne in den jungen Lebensjahren die Richtigkeit des elterlichen Verhaltens hinterfragen zu können, imitieren unsere Kinder ohne Weiteres unsere Essgewohnheiten und unser -verhalten. Zum Nachahmen gehört allerdings das Vorleben. Daher ist es natürlich umso wichtiger, als Eltern einen möglichst gesunden Lebensstil an den Tag zu legen. Über negative Essgewohnheiten der Eltern wie der Griff zum Feierabend-Bier oder zur Schokolade sollten daher zweimal nachgedacht werden. "Welche Signale sende ich mit diesem Verhalten an mein Kind?" Zudem das Brechen der eigenen Regeln wie keine Schokolade nach dem Abendessen auf dem Sofa extrem unglaubwürdig. Wollen wir selbst gute Vorbilder sein und unsere Kinder möglichst gesund prägen, müssen wir uns auch an unsere selbst aufgestellten Regeln halten.
Das Umstellen solcher häufig eingefahrenen Gewohnheiten ist nicht einfach, tut aber nicht nur dem Nachwuchs gut. Der Einfluss, den wir auf unsere Kinder haben, sollte auch als Chance gesehen werden: Wir können einen großen Beitrag dazu leisten, dass unsere Kinder gesunde Geschmackspräferenzen entwickeln und Lebensstilentscheidungen treffen.
Übrigens, die meisten Eltern unterschätzen ihre Kinder. So bald die Kleinen beidäugig sehen können, beobachten sie das Essverhalten der Eltern. Es ist überlebenswichtig, in den ersten beiden Lebensjahren richtig essen zu lernen. Eltern, die Gemüseesser sind, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch ein Gemüseesser Kind zu bekommen. Das funktioniert leider auch andersherum mit Junk Food. So beeinflussen Eltern unbewusst die spätere Gesundheit ihres Nachwuchses und womöglich sogar dessen schulischen (Miss-)Erfolg durch ein schlechtere Gehirnentwicklung, wie ich auch in meinem Buch "Die Macht der ersten 1000 Tage" schreibe.
Was ist, wenn die Großeltern das noch anders handhaben, dem Kind zur Belohnung öfter mal ein Bonbon anbieten – müssen wir da als Eltern eingreifen?
Gesunde Ernährung ist Teamwork. Daher ist es wichtig, dass auch Verwandte und Betreuungspersonen in die Ernährungsweisen der Kinder eingeweiht werden. Gerade Großeltern, die häufig mit anderen Regeln und Mitteln aufgewachsen sind, können die besten Ernährungsstrategien durchkreuzen, wenn mit ihnen im Vorfeld nicht richtig kommuniziert wurde. Ab und an mal ein Bonbon oder etwas Süßes generell ist sicherlich kein großer Fehler, allerdings ist es ratsam, dass Eltern in aller Deutlichkeit mit allen sprechen, die im Leben des Kindes eine Rolle spielen, und gleichzeitig Verständnis für die gut gemeinte Geste entgegenbringen. Besonders Großeltern drücken Zuwendung und Belohnung gern über das Essen aus – und ein Verwöhnen der Enkel ist absolut nicht falsch – aber bitte nicht mit Lebensmitteln. Viel besser sind Aufmerksamkeit, gemeinsam spielen oder kochen oder hinaus in die Natur gehen.
Gibt es ein "zu spät" für die Prägung hinsichtlich der Verknüpfung zwischen Essen und Gefühlen, oder können Eltern jederzeit noch das Ruder – zumindest für ihre Kinder – herumreißen?
Entscheidend für die Prägung des Essverhaltens sind die ersten 1.000 Tage im Leben – somit ab Beginn der Schwangerschaft bis hin ins zweite Lebensjahr des Kindes. Mit dem Kindergartenalter ist das kindliche Prägungsmuster in der Regel schon angelegt, obwohl die Gesellschaft erst dann mit dem Thema gesunde Ernährung beginnt. Doch auch eine spätere Umprägung auf gesündere Essgewohnheiten im späteren Kindesalter bis hin ins Erwachsenenalter ist noch möglich, wenn auch deutlich schwerer. Wenn früh versäumt wird, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln und nur wenige unterschiedliche Lebensmittel eingeführt werden, prägt das die Geschmacksvorlieben negativ. Je früher, umso besser und einfacher – Gänzlich zu spät ist es dafür allerdings nie, denn eine vielfältige gesunde Ernährung schützt vor Krankheiten und Mangelerscheinungen. Allerdings endet für viele Eltern ab der Pubertät der Einfluss auf das Verhalten ihrer Kinder. Die Peer Group und die Werbung haben jetzt die Vorbildfunktion übernommen. Sätze wie "Iss das, WEIL es gesund ist" bewirken auch schon bei Kleinkindern genau das Gegenteil – in der Pubertät erst recht.
In unserer Kultur (und vielen anderen auch) gehört Essen zum Feiern dazu. Ist dagegen etwas einzuwenden?
Heutzutage hat das Essen eine essenzielle gesellschaftliche Bedeutung und geht weit über die biologischen Aspekte der Nahrungsaufnahme hinaus. Mit dem Essen und der Geselligkeit, die dahintersteckt, verbinden wir Menschen sehr viel – egal, ob Geburtstage, Weihnachten oder das Grillfest im Sommer. Essen verbindet, und dass es in unserer Kultur zum Feiern dazugehört, ist nicht verwerflich. Häufig sind allerdings wenig gesundheitsfördernde Gerichte auf dem Buffet oder auf den Tellern zu finden und oftmals essen wir über unser Sättigungsgefühl hinaus – wenn schon, denn schon. In Ausnahmen ist dies kein gravierender Fehler, dennoch kann man selbst bei Feiern mit kleinen Kniffen (wie langsames und achtsames Essen oder Gemüse nicht als Beilage, sondern als Hauptkomponente wählen) gesündere Entscheidungen treffen. Aber Feiern sind ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass bestimmte Lebensmittel wie Cola oder Eiscreme hier ihre Berechtigung haben können, aber eben nicht im Alltag.
Wie sieht das aus, wenn man zum Beispiel Essen geht, um das Zeugnis (bzw. den Abschluss eines Schuljahres) zu feiern? Ist das aus Ernährungs- bzw. Prägungssicht auch schon ein falscher Ansatz?
Ausnahmen sind selbstverständlich völlig in Ordnung und zu besonderen Anlässen sind ungesunde Gerichte nicht verboten. Wichtig ist dabei, dass Süßes und Ungesundes nach bestimmten Regeln vermittelt werden und nur zu bestimmten Festlichkeiten zu Tage kommen. Eltern müssen dies ihren Kindern gegenüber deutlich kommunizieren. Und eine gesunde Ernährung wird durch nur wenige Ausnahmen über das Jahr verteilt auch nicht sofort ungesund. Eine 100-prozentige Konsequenz kann und soll von niemandem erwartet werden. Dass Ausnahmen normal und absolut menschlich sind, ist auch ein hervorzuhebender Bestandteil der Kindeserziehung rund um das Thema Essen – solange sie eben tatsächlich Ausnahmen bleiben und nicht zur Regel werden.




